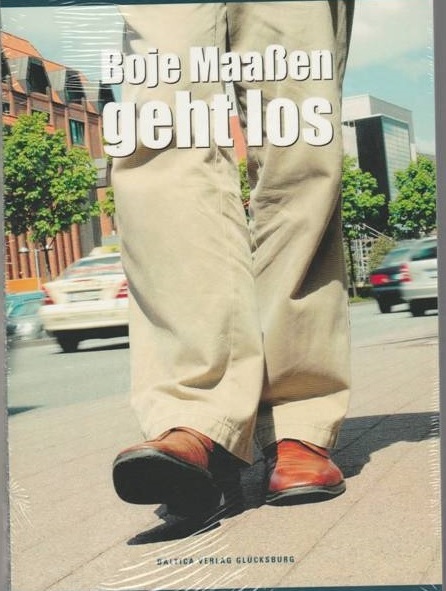Fremddokumente
Stand: 16. 8. 18
Radwegenetz ausbauen
22. August: Wo Hamburg zur Staufalle
wird
Nach Jahrzehnten der Bevorzugung des Automobils und
des Straßenbaus ist allmählich die Kapazitätsgrenze in den Städten
für den individuellen Autoverkehrs erreicht. Fast jede Baustelle und
fast jeder Unfall verursachen einen Kollaps. Also welche Wahl haben
wir? Mehr Straßenbau geht nicht und mehr Autos auch nicht. Es
besteht akuter Handlungsbedarf an dem Ausbau des ÖPNV und massiven
Ausbau den Radwegnetzes. Ich bin jetzt auf E-Bike umgestiegen und
fahre je 14 Kilometer in die City rein und raus. Direkt in der
Innenstadt gibt es relativ gute Möglichkeiten Fahrrad zu fahren,
aber in der Peripherie von Hamburg gibt es Fahrradwege, die den
Namen nicht verdienen und gefährlich sind. Hier sollte schnell und
gut Geld verbaut werden, damit wir Bürger nicht mehr vom Verkehr
reden, sondern einfach gut und gerne in Hamburg leben und arbeiten.
Till Westphalen, Bönningstedt
Energiefresser Laubbläser
13. August: Auch Halogenlampen werden nun
verboten. Nach dem Aus für die Glühbirnen verbannt die EU weitere
ineffiziente Leuchtmittel aus den Regalen
Während ich im Abendblatt lese, dass ich künftig meine
augenschonenden 20-Watt-Halogenlampen nicht mehr benutzen darf, pustet mein
Nachbar sein Grundstück mit einem 2000-Watt-Laubbläser staubfrei. Der andere
Nachbar ist mit seinem 250PS SUV unterwegs, um Energiesparlampen
einzukaufen. Was soll das? Bei der nächsten Wahl werde ich eine Partei
wählen, die diesen Blödsinn rückgängig macht.
Rainer Seekamp, per E-Mail
Weniger fliegen, weniger Ärger...
4. August: Luftraum überlastet – immermehr
Verspätungen
Die einfachste Lösung: Weniger fliegen, also weniger Ärger,
weniger Lärm, weniger Dreck in der Luft, weniger Benzinverbrauch. Wenn
Fluggesellschaften überbuchen, tun sie das, weil die Nachfrage so hoch ist –
aber muss das sein?
Christiane Röhling, Hamburg
30. Juli: Schock bei Arktis-Kreuzfahrt. Eisbär
verletzt deutsches Crewmitglied der MS ,Bremen‘ auf Spitzbergen. Raubtier
,aus Notwehr‘ getötet
Ihr obiger Bericht schockt mich nicht nur aus dem Grunde,
dass ein Crewmitglied der MS „Bremen“ verletzt wurde, sondern, dass ein
Eisbär in einem der letzten Refugien für diese Tiere sein Leben lassen
musste. Nehmen wir nicht vielfach den Tieren (und auch allen bei uns
heimischen Tieren) durch Bebauung, Straßen etc. ihren letzten Lebensraum?
Ich meine, die Reedereien sollten einmal überdenken, welche Ziele sie ihren
Kunden/Gästen anbieten. Es muss doch nicht unbedingt dorthin sein, wo Tiere
in ihrem natürlichen Lebensraum gestört werden.
Monika Ehlers, Großhansdorf
„Wir haben in der Oberstufe gelernt, was man unter
der „Gretchenfrage“ zu verstehen habe: Die Namensträgerin fragt Faust im
ersten Teil: „Wie hältst du’s, Heinrich, mit der Religion?“ Künftige um ihr
Wohl bangende Bräute werden mögliche Partnerschaften vielleicht an die
Antwort auf die Frage knüpfen: „Wie hältst du’s, Max, mit der
Digitalisierung?“ Es bildet sich ein neues Sozialverhalten heraus, nämlich
solches, das der „Selfierei“ eine Absage erteilen wird, das wird die
Minderheit sein, und solches, das sie weiterbetreibt mit allen damit
verbundenen Konsequenzen. Eine verschwindend kleine Elite wird
unüberschaubaren Massen an digitalen Frohnaturen gegenüberstehen, die ihr
Leben, ohne es zu ahnen, einem ungeahnten digitalen Nirwana opfern mit den
entsprechenden Folgen: Verlust an Realitätssinn und, damit verbunden,
Verlust an Beziehungsfähigkeit, wie sie sich bei entfesseltem Narzissmus
bereits weit verbreitet hat. Zwischenmenschlichkeit verträgt nur ein
eingegrenztes Maß an Ich. Deshalb ist Ihre Frage „Wann werden wir den Punkt
erreichen, an dem wir die Lust an der Digitalisierung verlieren?“ bereits
eine der Gretchenfragen Ihrer Generation“ ( Norbert Richter,
Henstedt-Ulzburg, im Hamburger Abendblatt)
Meine Ergänzung
„Die Gretchenfrage beantwortet
Dank an Norbert Richter für seinen
Leserbrief „Digitales Nirwana“ (v. 9. 7). Man muss aber meiner
Ansicht nach die kritische Analyse der Gegenwart von der Ebene der
Digitalisierung auf die Ebene der exzessiven Motorennutzung erweitern, um
das Ausmaß der Zerstörungen in der Lebenswelt angemessen zu beschreiben.
Erst dann erkennt man nämlich, warum den sonntäglichen Tatort anzuschauen
oder jede Distanz mit dem Auto zurückzulegen, für viele Bürger ein Muß ist.
Offensichtlich spürt man sich nur noch im Gruseln und im schnellen Fahren.
Eigenbewegung, Naturerfahrungen, Schönheiten im Nahbereich, soziale
Begegnungen, Kultur und Liebe sind aber die Alternativen, die das Leben
bietet, die aber zunehmend verschmäht werden“ (für das Hamburger Abendblatt,
nicht erschienen).
aus Flensburger Tageblatt - 17. 3. 18 v. Prof. Hauke
Mommsen
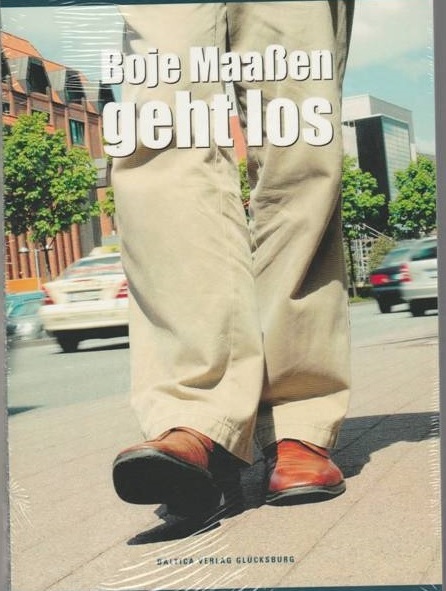
Was für ein Albtraum wenn man bedenkt, dass das nur
einen Punkt (die Zahl der SB-Kassen, bm)der menschenlos werdenden Welt
aufzeigt. Ich denke da an selbstfahrende Busse, Auslieferroboter usw.
Menschen sind soziale Wesen. Diese Entwicklung sollte nicht noch hofiert
werden. Nicht alles was machbar ist, muss auch so umgesetzt werden. Das
dabei noch Arbeitsplätze vernichtet werden, ist allen Befürwortern
anscheinend nicht bewusst.
Doris Schulze, per E-Mail im
Hamburger Abendblatt
Ich habe mich selten über einen Leserbrief so sehr
gefreut wie über diesen: Wenn wir nicht bei uns selbst beginnen, für die
Umwelt Verantwortung zu übernehmen und immer alles der Politik zuschieben,
werden nachfolgende Generationen die Rechnung bezahlen müssen. Man muss
nicht für zwei Tage mit Billigticket zum Shoppen nach London fliegen und man
kann sich auch bücken nach einer leeren Plastikflasche, die jemand einfach
achtlos ins Gebüsch warf und man könnte tatsächlich aus Umweltschutzgründen
auf eine Fahrt mit einem der Luxuspassagierschiffe, die als riesige
Dreckschleudern die Umwelt verpesten, verzichten. Oder auch tagtäglich bei
der Autobenutzung sich die Frage stellen, ob man nicht mit Rad oder zu Fuß
die Sache erledigen kann. Dieses Wort "verzichten" - freiwillig verzichten -
kennen wir fast nicht mehr. Also , noch einmal : Packen wir es an, - für
unsere Kinder und Enkel. Fangen wir bei uns im Alltag an, unser
Handeln zu überprüfen.
Martha Böttger, Witzwort shz
„ Denn sie wissen nicht ,was sie tun“ ,war der Titel
eines Hollywood Klassikers aus dem Jahre 1955,der einen Generationenkonflikt
zum Thema hatte. Wenn wir diesen Satz leicht verändert umdrehen,…“denn wir
tun nicht, was wir wissen,“ sind wir mitten in dem heutigen
Generationenkonflikt ,der darin besteht ,dass wir heute Lebenden wider
besseres Wissen durch unsere wenig nachhaltige Lebensweise künftigen
Generationen ,also unseren Kindern und Enkeln u.s.w. die Lebensgrundlagen
wegkonsumieren.
Wir alle ,der Verfasser eingeschlossen, wissen,
dass wir zu oft fliegen-zu Klimakonferenzen reisen bis zu 20000 Teilnehmer
per Flugzeug(!!) an- dass wir zu schwere Autos und kaufen und auf zu kurzen
Strecken oder viel zu schnell ohne Tempolimit fahren ,dass wir zu viel
Fleisch essen, zu viele Lebensmittel wegwerfen ,zu viele unfair,
menschenunwürdig hergestellte Waren( Smartphones, Klamotten) viel zu
schnell entsorgen , Müllberge produzieren und mit diesem Lebensstil unsere
Lebensgrundlagen Wasser, Luft und Boden zerstören werden. Warten wir also
nicht ,bis eine neue Regierung neue Klimazielvorgaben beschließt, sondern
„packen wir es an“, fangen wir heute an, jeder auf seine Weise ,mit seinen
Möglichkeiten, nachhaltiger zu leben, den Kindern und Enkeln dieser Welt
wird es nützen und gerecht werden.
Hans- Joachim Netzow, shz
Mich erstaunt immer wieder, mit welcher
Selbstverständlichkeit öffentliche Flächen für Privateigentum zur Verfügung
gestellt werden sollen und das natürlich kostenlos. Der Autobesitz ist aber
Privatsache und damit eigentlich auch die Unterbringung derselben. Wenn
jetzt knapp 780.000 Kfz in Hamburg zugelassen sind, hier aber über 1,8
Millionen Menschen leben, bedeutet dies ja, dass über eine Million kein Kfz
besitzen. Dies werden natürlich vor allem Kinder, Jugendliche und ältere
Menschen sein. Flächen sind in einer Großstadt wie Hamburg, insbesondere in
der inneren Stadt, nun einmal nur begrenzt vorhanden und diese sollten dafür
genutzt werden, die Stadt lebenswert für alle zu erhalten und nicht als
Abstellfläche. Der Mensch sollte aber immer vor dem Auto den in einer Stadt
begrenzt zur Verfügung stehenden Raum nutzen können.
Susanne Faltin, per E-Mail,
Leserbrief v. 28. 12. 17 im Hamurger Abendblatt
Flensburger Tageblatt v. 11. 8. 2017
Abgesang auf das Flensdorf
„Zwischen Flensdorf und Großstadt“ hatte
Oberbürgermeisterin Simone Lange im Sommer-Interview die Position der Stadt
im Spannungsfeld zwischen Wachstum und Lebensqualität verortet. Ein
Spannungsfeld, mit dem sich professionell ein zweiter Flensburger
beschäftigt, und zwar in Kassel. Dr. Ulf Hahne ist an der Uni dort Professor
für Nachhaltige Regionalentwicklung. Flensburgs Nöte, Flensburgs Sorgen,
Flensburgs Schätze und Flensburgs Sünden betrachtet Hahne aus der kritischen
Distanz, erlebt sie aber auch aus Bürgernähe. Im Interview macht er sich für
qualitatives Wachstum an der Förde stark und kritisiert den lässigen Umgang
mit den wenigen freien Flächen.
Hahne ist bekennender Stadtbewohner. Urbanität ist
ihm wichtig. Urbanität bedeutet Vielfalt und kurze Wege. Zur modernen
Urbanität fehle Flensburg aber noch so einiges. Moderne Urbanität könne man
beispielsweise in Kopenhagen studieren – wo in einem radikalen Schritt der
Fahrrad- und Fußgängerverkehr zu Lasten des Automobils kräftig aufgewertet
wurde. So könne eine ganz andere Lebendigkeit in die Stadt einziehen:
„Sicherheit hängt ja auch davon ab, wie viele Menschen auf der Straße sind“,
so Ulf Hahne. „Wenn sich die Leute alle in Autos bewegen, ist auf Wegen und
Plätzen nun einmal nichts los. Je mehr Menschen aber mit dem Rad oder zu Fuß
unterwegs sind, desto mehr Sicherheit geht davon aus. Das ist ja auch für
ältere Leute ein sehr wichtiges Thema. “
In Flensburg lasse sich die Dominanz des Autos
besonders beeindruckend an der Schiffbrücke studieren. „Flensburg sollte
sich ein anderes Konzept für den ruhenden Verkehr in der Innenstadt
überlegen“, fordert der Wissenschaftler. „Dazu gehört, zum Beispiel, dass
die attraktiven Flächen rund um den Hafen von der Stadtrendite her wenig
effektiv genutzt werden, indem man irgendwelche Blechkisten drauf abstellt.“
Er ist sicher, dass die Flächennutzung in diesem Bereich eines der
bestimmenden Themen der kommenden zehn Jahre wird.
Am Ostufer, wo für das gesamte Quartier ein neues
Konzept entstehen soll, warnt Hahne vor dem neuen Planungsinstrument
„Urbanes Gebiet“, das die Flensburger Stadtplanung dort gerne anwenden
möchte. Das baurechtliche Raster, das die Grenzen zwischen Gewerbe und
Wohnen fließender machen soll, birgt Gefahren, weil mehr Lärm erlaubt sei
als in einem Kerngebiet. „Das macht die Sache sehr problematisch“, sagt
Hahne und verweist direkt auf die Hamburger Hafencity. Der Krach vom anderen
Elbufer macht Wohnen in Teilbereichen der City zum Ausnahmetatbestand, dem
man nur mit hohem technischen Aufwand entgegenwirken könne. „Wohnen hätte
man dort gar nicht erlauben können.“ Es habe sich gezeigt, dass die
planerischen Vorgaben aus diesem Grund auch in der Hafencity nicht alle
umzusetzen waren. Für Jürgensby fürchtet Hahne den Effekt, der eintritt,
wenn der Schall einen Hang erklimmt. „Das addiert sich ziemlich schnell,
wenn er sich über dem Wasser verstärkt und in der Atriumlage nochmals
bündelt.“
Das „Flensdorf“ der Oberbürgermeisterin sieht er
nicht kommen. Flensburgs Neubaugebiete am Rande des eingemeindeten Dorfs
Tarup seien nicht als Mischgebiete konzipiert. Dörfliche Strukturen könnten
sich gar nicht etablieren. Aber das ist nicht nur ein Flensburger Problem.
„Die Neubaugebiete auf den Dörfern sehen auch nicht anders aus.“
– Quelle: https://www.shz.de/17535686 ©2017
Dazu das Interview mit Prof. Dr. Ulf Hahne
„Stadt ist Veränderung“
(Flensburger Tageblatt v. 11. 8. 17
Prof. Dr. Ulf Hahne, Flensburger, Regionalforscher und Hochschulprofessor an
der Uni Kassel über die Zukunft einer Stadt mit schwindendem Flächenangebot
Flensburg wächst, aber die Flächen sind begrenzt. Ist es überhaupt sinnvoll,
in so einer Lage das Wachstum über die Erschließung immer neuer
Einfamilienhausgebiete zu kanalisieren?
Ich glaube, Flensburg kann sehr gut damit punkten, indem es sagt: „Wir sind
die Stadt. Wir bieten eine urbane Lebensqualität.“ Das heißt ein bisschen
verdichteter, dafür ist alles relativ kompakt in der Nähe vorhanden. Noch
hat man aber diese mehrgleisige Stadtentwicklungspolitik, dass man auch die
Einfamilienhausbauer gerne ansiedeln möchte.
Tarup ist der am stärksten wachsende Stadtteil – überwiegend
Einfamilienhäuser.
Man schafft immer noch lauter Einzelhausgrundstücke und möchte dabei das
Dorf nachmachen. Aber es wird nirgends ein Dorf entstehen. Wenn man sich
diese Gebiete anguckt, dann sind sie weder nach Prinzipien des Dorfes mit
einem Zentrum und ähnlichem gestaltet noch sind sie als Mischgebiet
ausgewiesen, so dass es auch Gewerbe schwer hat, sich dort anzusiedeln. Das
heißt, dass automatisch für eine Funktionstrennung geplant wurde. Dies dann
als ländliches Wohnen auszugeben ist irreführend. Das ist Suburb-Wohnen und
nichts anderes.
Suburbia bringt aber Geld, sagt der Kämmerer .
Ob diese Rechnung unter Einbeziehung aller Kosten und Erträge aufgeht,
bezweifle ich. Alles, was man im Moment mit diesen neuen Quartieren schafft,
ist ja, dass man Verkehr erzeugt und in Gegenden hinein lenkt, wo man bisher
keine öffentliche Verkehrserschließung hatte. In diesen neuen Quartieren
brauche ich aber eine Verkehrsanbindung, ich brauche Einkaufsmöglichkeiten,
dann brauche ich eine vernünftige Kinderbetreuung, Schulversorgung,
schließlich auch medizinische Versorgung, denn in diese neuen Quartiere
ziehen üblicherweise Familien mit Kindern. Das heißt, ich muss zusätzlich
bauen, und ich habe Kosten, die sich möglicherweise nicht rechnen. Außerdem:
Wenn ich so ein autogerechtes Quartier schaffe, zwinge ich ja die Menschen
dazu, dass sie mit dem Auto unterwegs sind, und das heißt, dass sie ihre
Versorgungsbeziehung, weil vor Ort zunächst noch nichts ist, erst einmal
ganz woanders aufbauen, möglicherweise bleibt das dann auch so.
Was halten Sie von sozialer Durchmischung neuer Wohnquartiere? In einem
Taruper Einfamilienhausgebiet beispielsweise regte sich Widerstand gegen
fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser im geförderten Wohnungsbau?
Wir haben eine fatale Tendenz zur Abschottung unserer Gesellschaft vor
Einflüssen, die wir nicht haben wollen oder nicht sehen wollen. Dabei sind
wir eine Gesellschaft, und wir gehören zusammen. Je stärker, auch im
Sozialen, ein Quartier gemischt ist, desto toleranter werden die Menschen
auch – auf allen Seiten. Ich sehe das als großen Vorteil. Und gemischte
Stadt heißt ja nicht, dass man jetzt nur an Wohnen und Gewerbe als Elemente
der Mischung denkt, sondern es heißt gerade auch soziale Mischung. Sonst
schaffen wir nämlich lauter Gettos.
Das spricht für Verdichten im vorhandenen städtischen Raum? Was für Impulse
braucht die Innenstadt denn dann?
Ich finde, Flensburg muss sich dazu bekennen, dass es eine Stadt ist und
urbane Atmosphäre schaffen muss. Wenn wir irgendwo Nachhaltigkeitsziele
ernst nehmen – und dazu gehört das Flächenspar-Ziel – dann müssen wir in die
Höhe bauen. Das ist eine ganz normale Konsequenz und in ganz vielen Städten
auch üblich. Zugegeben: Das geht oft zu Lasten der Bevölkerung in den alten
Quartieren, die mal unter ganz anderen Bedingungen dorthin gezogen ist und
jetzt erheblich unter Veränderungen zu leiden hat. Aber auch das ist Stadt.
Stadt ist Veränderung.
Wie schafft man es, den verdichteten Raum gleichzeitig attraktiv zu
gestalten?
Die moderne, jüngere Stadtplanung geht davon aus, dass man sagt, eine Stadt
ist dann lebendig, wenn sie vornehmlich für Fußgänger und Radfahrer gut
erschlossen ist. Und insofern muss die Erschließung in dieser Richtung
deutlich verbessert werden. Da ist der Punkt, an dem sich entscheidet, wie
lebendig, wie lebenswert eine Stadt ist. Dazu gehört das Thema Sicherheit,
dazu gehört das Thema Gesundheit, dazu gehört das Thema Nachhaltigkeit. Dies
haben uns die Dänen voraus – und mit Jan Gehl einen Architekten, der als
Denker für lebenswerte Städte dort Vorbild ist. Man sieht ja an den größeren
Städten in Dänemark, dass es ein gutes Modell ist, eine größere Stadt wie
Kopenhagen relativ radikal im individuellen Autoverkehr einzuschränken und
andere Verkehrsformen attraktiv zu machen. Ein gutes Modell übrigens auch
für die ältere Bevölkerung. Es gibt heute Pedelecs und E-Bikes und ähnliches
mehr, die körperliche Anstrengung ist heute gar nicht mehr das zentrale
Thema.
Bekanntermaßen gehen der kreisfreien Stadt Flensburg langsam, aber sicher
die Flächen für Wohnen und Gewerbe aus. Da stellt sich die Frage nach dem
Wert des Wachstums.
Die Frage ob eine Stadt wachsen muss, wird immer wieder gestellt, es gibt
eine lange Debatte darüber, ob es so etwas wie eine optimale Stadtgröße
gibt. Ich denke für die Bewohner ist es relativ egal, ob die Stadt 90 000
oder 150 000 Einwohner hat, wenn nur die Qualität stimmt. Und das müsste
eigentlich die Debatte sein. Wir reden aber über Wachstum in Flensburg
deshalb, weil die Stadt hoch verschuldet ist. Die Stadtpolitik braucht
Wachstum. Die Bürger brauchen es nicht. Und viele Unternehmen brauchen es
auch nicht.
Wachstum muss man also nicht zwingend nur quantitativ, sondern auch
qualitativ definieren?
Die Wachstumsfrage entscheidet sich an der Attraktivität. Wie lebenswert ist
es, in Flensburg zu wohnen und zu arbeiten? Dafür
Entwicklungsvoraussetzungen zu schaffen, das ist das Wichtige. Dynamik ist
das Kennzeichen einer lebendigen Stadt. Da kann man sich Ziele setzen und
auch mal langsam wachsen.
Wichtig wird es sein, junge Leute an das provinzielle Flensburg zu binden.
Kann das gelingen?
Wir sind ja ein Stück weit Schwarmstadt, weil viele junge Leute heute zum
Abitur gebracht werden, viel mehr als vor 20, noch viel mehr als vor 40
Jahren. Diese werden alle auf einen Bildungsweg getrimmt, der irgendetwas
mit Studium zu tun hat. Was aber passiert, wenn bei Einsätzen der
demografischen Welle ab 2020 die Zahl der jungen Menschen deutlich sinkt? Wo
steht Flensburg dann mit seinen Hochschulen? Kann es als attraktives
Einzugsgebiet dann noch dienen? Hat man andere Studiengänge aufgebaut, etwa
im Masterbereich, die dazu führen, dass von weit weg möglicherweise auch
internationale Studierende kommen, weil sie genau diesen Studiengang haben
wollen, den sie hier finden und woanders nicht? Das ist auch Attraktivität
von Stadt. Die mobilsten Menschen sind die jungen Leute.
Mobil sein kann aber auch bedeuten, dass die Jungen ganz flott in die
Metropolen umziehen.
Es ist die Frage, welche Ansprüche wir an Lebensqualität stellen. Junge
Leute, die im Regelfall nur über ein geringes Einkommen verfügen, haben von
daher schon immer nach anderen Lebensformen gesucht und denken heute den
Lebenszyklus ganz anders. Da spielen kooperatives Wirtschaften, Versorgung
aus der Nähe, regionale Ernährung, neue Formen des Wohnens in Baugruppen,
Konzepte für die längere Nutzungsdauer von Produkten und Ähnliches eine
Rolle. Das finde ich spannend, und ich kann mir vorstellen, dass dies ein
kleines Stück kulturellen Wandels in den Städten bedeutet, der dazu führt,
dass dieser Zwang, wegen eines guten Arbeitsplatzes und der Karriere wegen
aus Flensburg weg zu gehen, etwas abnimmt. Dafür attraktive Bedingungen zu
schaffen, das wäre eigentlich auch toll.
Attraktivitäts-Wachstum kommt zur Not ohne Flächen aus, Wirtschaftswachstum
nicht. Wäre da nicht eine Fusion mit den Nachbarn sinnvoll?
Gemeindefusionen und Gebietsreformen sind eine zwiespältige Angelegenheit.
Sie schaffen größere administrative Effizienz, sicher. Aber auf der anderen
Seite schaffen sie auch das Problem, dass die politische Verantwortung auf
weniger Köpfe verteilt wird. Die Bereitschaft der Menschen, sich zu
engagieren, ist in den kleinen Quartieren weitaus größer. Deshalb sind
eigentlich die negativen Kosten solcher Gebietsreformen immer, dass das
ehrenamtliche und das politische Engagement der Bürger sinkt. Überall dort,
wo wir in den letzten Jahren Gemeindegebietsreformen hatten, ist das zum
Thema geworden, und es zeigte sich, dass unendlich viele Parlamentssitze
verschwanden. Mag sein, dass es administrativ effizient ist, aber
demokratiepolitisch betrachtet ist es kein besonders guter Weg, die Bürger
so aus dem Politischen heraus zu nehmen. Untersuchungen haben ergeben, dass
mit dieser Entwicklung oft auch ein Erstarken der rechtspopulistischen
Parteien einherging.
Also lieber begrenzte Kooperationsmodelle?
Überall da, wo es die Bereitschaft zu Gesprächen gibt, kommen manchmal
erstaunliche Lösungen zustande. Wir machen ohne Probleme interkommunale
Gewerbegebiete – auch hier in der Region. Grundsätzlich aber sind unsere
ganzen institutionellen Rahmenbedingungen so, dass Kommunen jeweils
egoistisch für sich planen und natürlich sehen, was sie aus der jeweiligen
Stadt-Umland-Situation für sich an Vorteilen ziehen können. Wenn man da
nicht in eine geregelte Kooperation kommt, dann wird es weiterhin diesen
Wettbewerb auch um die Einwohner geben. Das führt dazu, dass in einer Stadt
wie Flensburg die letzten möglichen Flächen in irgendeiner Weise aktiviert
werden und, dass eben auch im Umland Flächen aktiviert werden. Dabei wissen
wir alle, dass wir in absehbarer Zeit in der Gesamtregion einen deutlichen
Bevölkerungsrückgang haben werden. Und dann setzt der neue Wettbewerb ein:
Wo bleiben die Einwohner, die dann noch da sind?
Was halten Sie von der Quartierplanung am Hafen-Ostufer?
Das sind wunderbar innerstädtisch gelegene Flächen mit hoher Attraktivität
für eine sinnvolle Mischnutzung. Nun kann man sich vorstellen, dass der
Abriss der großen Silos ein irrsinnig teures Unterfangen ist, aber man muss
da ran und ein ganz besonderes Quartier machen. Möglicherweise könnte man
das als nationales Projekt des Städtebaus auf Bundesebene darstellen. Wenn
man das einem Rendite-orientierten privaten Investor mit allen Kosten
überlässt, dann müsste dieser sehr, sehr hoch bauen. Das würde sich der
Silhouette Flensburgs nicht anpassen und wäre ein Konfliktfeld, das ganz
sicher nicht die Attraktivität der Stadt erhöht. Das Werftkontor ist mir
eigentlich schon ein Geschoss zu hoch.
Die Ostuferbebauung ist nach Ansicht vieler Flensburger ohnehin nicht
besonders geglückt. Über welche Bausünden werden sie wohl in 50 Jahren
sprechen?
Architektonisch kann man vieles kritisieren, wobei man jetzt schon sagen
kann, die Halbwertzeit von Klarschiff und ähnlichen „modernen“ Gebäuden wird
nicht besonders lang sein. Städtebaulich sind die größten Sünden diejenigen,
die wir im Moment in den neuen Einfamilienhausgebieten machen. Das andere
Problematische, das im Moment geschieht, ist die energetische Sanierung im
Bestand. Diese Dämmungsarie, die da läuft, ist das Feld, auf dem wir im
Moment die größten Sünden begehen. Wegen relativ kurzfristiger
energiepolitischer Ziele, die uns möglicherweise in 50 Jahren überhaupt
nicht mehr interessieren. Da werden wir uns die Frage – was habt Ihr bloß
aus Eurer Bausubstanz gemacht? – gefallen lassen müssen. Was Städte
unterschiedlich macht, nehmen wir gerade weg.
Vielleicht ist das ja nur eine Zeitfrage. Flensburgs alte
Einfamilienhausgebiete – Beispiel Monokel-Viertel – gelten mittlerweile als
architektonische Kleinodien.
Im Monokel-Viertel sieht man ja, dass dahinter ein städtebauliches Konzept
stand. In Tarup-Südost sieht man hingegen kein Konzept verwirklicht. Das ist
der Versuch, möglichst viele Einwohner mit ihren spezifischen Wünschen
hierher zu holen und ihnen selbstbestimmtes Bauen zu ermöglichen.
Herausgekommen sind lauter Einzelbauten, die nicht zusammengehören. Der eine
hat eine Blockhütte, der andere nebenan eine Toskana-Villa. Der eine hat
einen Öko-Garten und daneben ist dann die wunderbare Kiesfläche, die ich aus
jedem amerikanischen Suburb auch kenne. Das hat mit Städtebau nichts mehr zu
tun, das ist sozusagen die Verabschiedung von Städtebau. Das finde ich sehr,
sehr schade.
Interview: Holger Ohlsen
Die Erfahrung von Freiheit und ihre Grenzen.
Kleine Philosophie des Fahrradfahrens
Von Constantin Hühn
(aus "autofrei leben")

Mit dem Fahrrad Widerstände überwinden: Radfahrer auf
einer überfluteten Straße in Köln (pa/dpa/Gambarini)
"Auf eure Räder, um das Leben zu ändern!" forderte
der Ehtnologe Marc Augé. Denn wer Fahrrad fährt, erfährt Freiheit und
Unabhängigkeit. Und gleichzeitig die Grenzen der Freiheit: etwa wenn Frauen
mancherorts das Fahrradfahren noch immer verboten ist.
Der Wind rauscht in meinen Ohren, ich beuge mich ein bisschen tiefer über
die Lenkstange. Je stärker der Wind mir entgegenbläst, desto kräftiger trete
ich in die Pedale: links, rechts, links, rechts. Ich spüre meinen Atem
schneller werden. Endlich biege ich ab und der Widerstand lässt nach. Mit
dem Wind im Rücken richte ich mich auf, strecke die Arme zur Seite – und
glaube, jeden Moment abzuheben.
"Das Fahrrad ist Teil unser aller Lebensgeschichte"
Wenn wir Fahrrad fahren, erfahren wir uns ein Stück Freiheit. Jeden Tag
aufs Neue, wenn die S-Bahn streikt oder der Benzinpreis steigt. Aber auch in
unserer persönlichen Entwicklung, wenn wir uns damit nach und nach die Welt
erobern. Für den französischen Ethnologen Marc Augé ist das Fahrrad
untrennbar verbunden mit dem Erwachsenwerden:
"Das Fahrrad ist Teil unser aller Lebensgeschichte. Es fahren zu
lernen, knüpft sich an besondere Momente unserer Kindheit und Jugend. Durch
das Fahrrad hat jeder ein bisschen von seinen körperlichen Fähigkeiten
entdeckt und eine Kostprobe der Freiheit erfahren, die sich damit
verbindet."
Marc
Augé bei einem Auftritt im Jahr 2016 (imago/Pacific Press Agency/Marco
Destefanis)
Als ich mit fünf Jahren Fahrradfahren gelernt habe, war das mein erster
Schritt in die Unabhängigkeit: erst mit Stützrädern, dann mit der
elterlichen Hand auf dem Rücken. Bis ich schließlich ganz ohne Hilfestellung
davongeradelt bin: zu meinen Freunden, am anderen Ende der Stadt. Seither
haben mich meine wechselnden Fahrräder zuverlässig hunderte Kilometer durch
die Welt getragen. Ganz ohne Treibstoff, nur durch eigene Körperkraft und
mechanische Raffinesse. Wie es eine frühe Fahrradenthusiastin ausdrückte:
"Die Maschine ist stets gebrauchsfertig. Frei und unabhängig von
allem andern kann man auf die Minute bestimmen, wann und wo man sein will."
Radfahrende Frauen entscheidend für die Emanzipation
Vorbei an stehenden Stahlkolonnen, durch enge Gassen und zur Not ein
Stück über den Gehweg. Das Radfahren ermöglicht, mit Immanuel Kant
gesprochen, einen ganz konkreten "Ausgang aus der Unmündigkeit". Und zwar
nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch gesellschaftlich: Noch vor 100
Jahren war eine Frau auf dem Fahrrad für manche ein Skandal. Als trotzdem
immer mehr Frauen radelten, war das in den Augen mancher Frauenrechtlerinnen
entscheidender für die Emanzipation als alle Bestrebungen der Frauenbewegung
zusammen. Und die französische Schauspielerin Sarah Bernhardt war sich
sicher:
"Ich glaube, dass die Benutzung von Fahrrädern dabei ist, unsere
Sitten tiefgriefender zu verändern, als man sich allgemein noch im Zweifel
ist. All diese jungen Frauen, die losfahren und den Raum erobern, hängen
einen Großteil des häuslichen Lebens an den Nagel."
 Fahrradfahren
verändert die Sitten: Im 19. Jahrhundert galten Frauen auf dem Rad
vielerorts noch als Skandal. (imago/Leemage)
Fahrradfahren
verändert die Sitten: Im 19. Jahrhundert galten Frauen auf dem Rad
vielerorts noch als Skandal. (imago/Leemage)
Fahrradfahren macht uns freier. Und konfrontiert uns zugleich mit den
Grenzen dieser Freiheit: Meine eigenen begrenzten Fähigkeiten – wenn ich
hinfalle oder einen Berg nicht schaffe. Die Widerständigkeit des technischen
Materials – wenn mal wieder die Kette abspringt oder die Luft raus ist.
Und schließlich politische Einschränkungen der Freiheit: Etwa, wenn
Frauen mancherorts immer noch nicht auf den Sattel steigen dürfen. Der Film
"Das Mädchen Wadjda" der saudi-arabischen Regisseurin Haifaa Al Mansour
erzählt von dieser Bevormundung. Aber auch, wie die Protagonistin mit öallen
Mitteln dafür kämpft, trotzdem Fahrrad zu fahren.
Eine Aufforderung, Widerstände zu überwinden
Und so stachelt uns das Radfahren im Idealfall auch dazu an, Widerstände
zu überwinden, Grenzen zu verschieben: "Auf eure Räder, um das Leben zu
ändern! Radsport ist Humanismus", wie Marc Augé schreibt.
Für Marc Augé ist das Fahrradfahren Ausgangspunkt für eine 'effektive
urbane Utopie': technischer Fortschritt, der allen gut tut und niemandem
schadet. Ökologisch nachhaltig und gesellschaftlich egalitär. Bis zur
Verwirklichung dieser Utopie ist es noch ein steiler Weg. Mit ein paar mehr
Radwegen ist es nicht getan. Aber möglich ist sie. Schalten wir also ein
paar Gänge runter, um den Anstieg zu schaffen.
Eine KritikWenn die
Politik mal wieder vor der Keule Arbeitsplätze einknickt, sollte sie mal
eine reale Rechnung aufmachen: Grob gerechnet finanzieren zehn
Fahrzeughalter einen Arbeitsplatz im Umfeld Straßenverkehr. Das ergibt sich
aus den Kosten, die alleine dafür anfallen, dass das Blechmöbel vor der Tür
steht, ohne einen Meter gefahren zu sein. Zu diesem Umfeld gehören alle, die
an der Aufrechterhaltung dieses Verkehrs beteiligt sind, also Verwaltung,
Aufsicht, Infrastruktur, Service, Versicherung und schließlich noch die
Fahrzeugherstellung. Über ein Fahrzeugleben gerechnet, belaufen sich die
Haltungskosten etwa gleichauf mit den Anschaffungskosten, die enthalten dann
aber noch einiges an Materialkosten und reichlich Gewinnaufschlag, sodass
vielleicht 30 Prozent noch für die vielzitierten Arbeitsplätze übrig
bleiben. Somit haben jetzt zehn Käufer ihr sauer verdientes Geld in ein
Produkt gesteckt, das sie jetzt nicht mehr so nutzen können wie geplant, nur
weil man ihnen allerlei überflüssigen Schnickschnack angedreht hat anstelle
solider Technik. Und sie sollen das jetzt hinnehmen, damit einer seinen Job
behält? Das sind doch auch alles Wähler. Umgekehrt würde das Streichen eines
Jobs in den Vorständen mindestens zehn Arbeitsplätze in der Produktion
finanzieren. Bei dem Exportanteil sollte das Argument Arbeitsplätze bei
unserer Regierung auch nicht ziehen, hat man doch mit diesem Betrug noch
viel mehr dieser Arbeitsplätze riskiert, die jetzt durch das verlorene
Renommee Made in Germany gefährdet sind.(aus „autofrei leben“)
Auch eine Kritik
Die Fakten am Ballindamm – mehr Fußweg, weniger
Straße. Sechs Millionen Euro werden in die Neugestaltung investiert. Ein
Fahrstreifen und 73 Parkplätze fallen weg. Kritik von der Opposition
Dazu ein „konservativer“ Leserbrief:
„Irgendwie muss es doch zu schaffen sein, die Innenstadt totzukriegen. So
scheint die Richtung des rot-grünen Senats zu sein. Nach der unsäglichen
Busbeschleunigung, bei der die Linie 5 schon Millionen verschlungen hat, um
am Ende drei Minuten schneller zu sein zwischen Rathaus und Burgwedel, dem
Supergau mit den die Radfahrer noch mehr gefährdenden Wegen um die
Außenalster, jetzt also der nächste Infrastrukturunsinn. Es wird nur noch
eine Frage der Zeit sein, wann die Menschen in das Umland ausweichen und die
anderen Einkaufszentren nutzen werden, um schnell und vor allem bequem ihre
Wochenendeinkäufe erledigen zu können. Und zwar mit der ganzen Familie, um
dann die Einkäufe nicht in schweren Taschen und überfüllten Bussen und
Bahnen nach Hause zu bringen. Statt sich um die wirklichen Belange der
Menschen zu kümmern, begrüßt der Herr Bürgermeister lieber internationale
Staatsgäste zum G20-Gipfel am Flughafen und legt nach dem Chaoswochenende
ein betroffenes Gesicht auf.“ (aus einem Leserbrief im Hamburger Abendblatt)